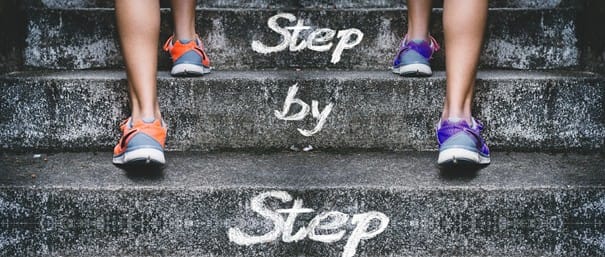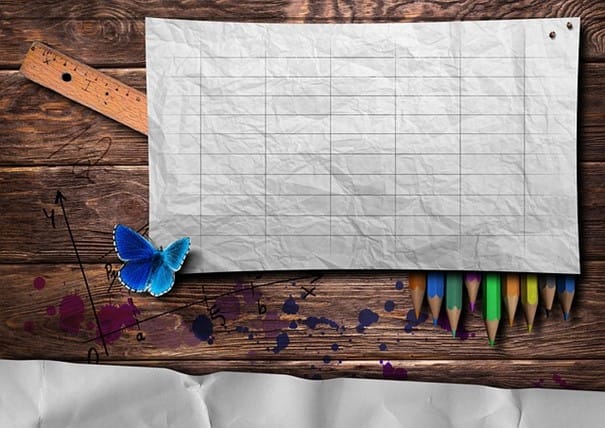Lernen ist eine spannende und oft herausfordernde Reise. Manchmal kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten oder den gewünschten Lernerfolg zu erzielen, insbesondere, wenn die Konzentration erschöpft, die Lernzeit knapp oder die Methoden nicht optimal sind. In einem solchen Fall kann uns das ökonomische Prinzip weiterhelfen – ein Konzept aus der Wirtschaft, das wir auch auf den Lernprozess übertragen können.

Was besagt das ökonomische Prinzip?
Ähnlich wie in der Geschäftswelt sind auch die persönlichen Lern-Ressourcen begrenzt. Sind im Unternehmenskontext eher die finanziellen Mittel, das vorhandenen Material oder das verfügbare Personal limitiert, sind im persönlichen Bereich Ressourcen wie Zeit, Aufmerksamkeit und Motivation ebenfalls nicht unendlich vorhanden. Zeit ist ein knappes Gut, die Konzentrationsfähigkeit ist begrenzt und Lernmaterialien sind oft kostenintensiv in der Anschaffung. Daher sollten wir mit unseren Ressourcen bewusst wirtschaften und sie möglichst effektiv und effizient einsetzen. Hierbei kann uns das ökonomische Prinzip unterstützen.
Das ökonomische Prinzip besteht eigentlich aus zwei unterschiedlichen Prinzipien:
Maximalprinzip
Mit den verfügbaren Ressourcen (z. B. Zeit oder Energie) wird das bestmögliche Ergebnis erzielt. Verglichen mit einem Unternehmen entsprechen unsere Ressourcen dem Input oder Aufwand und das Lernergebnis dem gewünschten Output oder Ertrag.
Beispiel: Mit 100 Litern Benzin möglichst weit fahren.
Minimalprinzip
Ein festgelegtes Ziel (also ein gegebener Output oder Ertrag) wird mit möglichst geringem Mitteleinsatz (= Aufwand oder Input) erreicht.
Beispiel: 100 km mit möglichst wenig Benzin fahren.
Bei der Formulierung des ökonomischen Prinzips ist es wichtig zu beachten, dass entweder der Input oder der Output gegeben bzw. festgelegt sein muss. Nicht ökonomisch ist es, mit minimalem Mitteleinsatz einen maximalen Output erreichen zu wollen!
Übertragen auf den Lernprozess bedeutet das, dass wir unsere persönlichen Ressourcen so effizient wie möglich einsetzen sollten, um unsere Lernziele zu erreichen.
Maximalprinzip beim Lernen: So viel wie möglich aus einem festgelegten Zeitraum herausholen
Das Maximalprinzip ist besonders hilfreich, wenn ein großes Ziel in einer bestimmten Zeit erreicht werden soll. Vielleicht steht eine Prüfung an oder ein komplexes Thema muss in kurzer Zeit gemeistert werden.
Beispiel:
Stellen wir uns vor, wir haben nur eine Woche Zeit, um uns auf eine wichtige Klausur oder eine kritische Prüfung vorzubereiten. Diese begrenzte Zeit möchten wir möglichst optimal nutzen, um das bestmögliche (maximale) Ergebnis zu erzielen. Das kann die bestmögliche Note innerhalb dieser begrenzten Zeit sein oder auch, das Maximum an Wissen über ein bestimmtes Themengebiet in diesem festgelegten Zeitraum zu erwerben. Das Maximalprinzip ist universell einsetzbar und kann bei allen Lernthemen und -inhalten eingesetzt werden. Nicht wirtschaftlich (und oft auch unrealistisch) ist jedoch die Vorstellung, mit minimalem Lernaufwand die maximale bzw. bestmögliche Note zu erzielen.
Die folgenden Fragen spielen generell bei Lernprozessen eine wichtige Rolle und können auch auf das Lernen nach dem ökonomischen Prinzip angewendet werden:
- Was ist mein Ziel?
Was möchte ich mit diesem Lernprozess erreichen?
Beispiel: Eine Prüfung erfolgreich bestehen, ein komplexes Thema verstehen oder eine neue Fähigkeit erlernen. - Welche Mittel und Ressourcen stehen mir zur Verfügung?
- Wie viel Zeit habe ich zur Verfügung?
- Welche Lernmaterialien kann ich nutzen?
- Welche Lernmethoden und -techniken kann ich verwenden?
- Wie kann ich meine Motivation aufrechterhalten?
- Wen kann ich um Unterstützung bitten?
Beispiel: Freunde, Familie, Lerngruppe, Mitschüler, Ausbilder, Lehrer …
- Wie kann ich meine Ressourcen optimal einsetzen?
- Welche Lernmethoden passen am besten zu mir und meinen persönlichen Stärken?
- Wie plane ich meine Zeit möglichst effektiv, um den mir zur Verfügung stehenden Zeitrahmen bestmöglich zu nutzen?
- Wie kann ich den Lernprozess effizient gestalten?
- Welche Techniken kann ich verwenden, um Informationen schneller und besser zu verstehen, z. B. Mindmapping, Schnelllesetechniken oder visuelle Darstellungen?
- Gibt es Methoden, die mir helfen, die Lerninhalte besser in meinem Gedächtnis zu verankern?
- Wie kann ich die Lerninhalte erfassen und verstehen, um sie nicht nur wiederzugeben, sondern auch auf andere Kontexte oder Situationen transferieren zu können?
- Wie kann ich meine vorhandenen Fähigkeiten und Stärken optimal beim Lernen einsetzen?
- Wie kann ich möglichst abwechslungsreich, vielfältig und multisensorisch lernen?
- Wie messe ich meinen Lernfortschritt?
- Wie kann ich regelmäßig überprüfen, ob ich auf dem richtigen Weg bin, mein Lernziel auch tatsächlich zu erreichen?
- Welche Personen, Methoden oder Kontrollinstrumente können mir ein Feedback zu meinen Lernfortschritten geben?
- Was kann ich tun, um Lernhindernisse zu überwinden?
- Welche möglichen Ablenkungen können beim Lernen auftreten und meinen Lernprozess negativ beeinträchtigen, z. B. Handy, Lärm, störende Gespräche?
Wie kann ich diesen Störungen vorbeugen? Wie kann ich sie überwinden, wenn sie sich nicht vermeiden lassen? - Wie bleibe ich motiviert, um das maximale Potenzial aus meiner verfügbaren Lernzeit herauszuholen?
- Welche möglichen Ablenkungen können beim Lernen auftreten und meinen Lernprozess negativ beeinträchtigen, z. B. Handy, Lärm, störende Gespräche?
- Wie kann ich meine Leistung weiter steigern?
- Welche Anpassungen oder Verbesserungen kann ich vornehmen, um noch effizienter zu lernen?
- Gibt es noch ungenutzte Ressourcen oder Techniken, die ich ausprobieren kann?
Solche Fragen helfen dabei, den Lernprozess effizient zu gestalten und mit den vorhandenen Ressourcen den maximalen Lernerfolg zu erzielen.
Minimalprinzip beim Lernen: Festgelegte Ziele mit minimalem Aufwand erreichen
Das Minimalprinzip ist nützlich, wenn ein bestimmtes (überschaubares und gut planbares) Lernziel mit dem geringstmöglichen Aufwand erreicht werden soll. Dabei konzentrieren wir uns ausschließlich auf die wesentlichen Lerninhalte und versuchen, den Lernaufwand möglichst zu reduzieren. So können wichtige Ressourcen gespart und für andere Dinge oder Lernthemen genutzt werden. Das Minimalprinzip bietet sich vor allem bei faktenbasiertem Lernen wie Vokabeln, Definitionen oder Formeln, beim Wiederholen oder bei Themen an, die bereits bekannt sind und wo ausreichend Vorwissen vorhanden ist.
Beispiel
Nehmen wir an, für einen Test müssen wir nur bestimmte Inhalte beherrschen, z. B. bestimmte Formeln, Definitionen oder vorgegebene Vokabeln. Dieses gegebene Ziel wollen wir mit minimalem Lernaufwand erreichen.
Auch bei dieser Variante des ökonomischen Prinzips benötigen wir ein klar definiertes Lernziel. Aber wie kann man nun den Lernaufwand möglichst minimieren? Hier kommen jetzt unsere verschiedenen Ressourcen ins Spiel. Die Verwendung von effektiven Lernmethoden und -strategien kann den Lernaufwand deutlich reduzieren. Weiterhin können bestimmte Gedächtnistechniken helfen, die Informationen besser im Gedächtnis abzuspeichern und so langfristig zu behalten. Dabei spielen auch regelmäßige und gut geplante Wiederholungen eine wichtige Rolle. Konzentriertes und fokussiertes Lernen minimiert ebenfalls den Lernaufwand. Sind wir hoch motiviert, lernen wir ebenfalls effizienter und verschwenden weniger Energie. Dahingegen kann ein Mangel an Motivation den Lernaufwand unnötig erhöhen. Auch die eingesetzten Lernmittel können den Lernaufwand beeinflussen. Hier sollte man darauf achten, dass die verwendeten Aufgaben, Apps oder Videos auch wirklich zum eigentlichen Lernthema passen und man sich nicht durch die Medienvielfalt ablenken lässt. Für viele Lehrbücher gibt es im Buchhandel passende Übungsbücher, die genau zum Stoffplan passen, die Übungen aus dem Lehrbuch optimal ergänzen und in der Regel auch eine Musterlösung enthalten. So spart man sich eine zeitintensive Onlinerecherche nach passenden Übungsaufgaben und möglicherweise nicht vorhandenen Lösungen.
Allerdings ist die Frage, welcher Lernaufwand denn nun wirklich minimal ist und zur Zielerreichung ausreicht, gar nicht so leicht zu beantworten. Sie hängt in erster Linie von individuellen Faktoren wie Vorwissen, Lernmethoden und Zielvorgaben ab. Lernt man zu wenig, kann das festgelegte Lernziel gefährdet sein. Lernt man zu viel, hat man unter Umständen nicht mehr das Gefühl, nach dem Minimalprinzip zu handeln. Aus diesem Grund sollte der Lern- bzw. Zeitaufwand im Verhältnis zum Lernziel bzw. zum angestrebten Ergebnis stehen. Pauschal kann man sagen, dass der Zeitaufwand im Verhältnis zum Ergebnis minimal ist, wenn die Lernzeit gezielt für das Lernen der relevanten und wichtigen Inhalte einsetzt wird, ohne dass Ressourcen unnötig verbraucht oder gar verschwendet werden.
Das Minimalprinzip sorgt dafür, dass wir uns auf die wesentlichen Lernziele fokussieren und unseren Aufwand minimieren, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
So setzen wir das ökonomische Prinzip bei Lernzielen um
Klare Lernziele setzen
Um den Lernprozess effizient zu gestalten, sollten wir unsere Lernziele präzise formulieren. Ein konkretes Ziel wie „Ich möchte in diesem Monat mein Englischvokabular um 50 neue Wörter erweitern“ hilft uns, den Fokus zu behalten und unsere Zeit sinnvoll zu nutzen.
Lernaufwand planen
Überlegen wir, wie viel Zeit und Energie wir für unser Lernziel aufbringen können und wählen das passende Prinzip aus. Möchten wir aus der uns zur Verfügung stehenden Zeit das Maximum an Wissen bzw. die bestmögliche Note herausholen (= Maximalprinzip)? Oder wollen wir gezielt und mit minimalem Aufwand ein festgelegtes Ziel erreichen (= Minimalprinzip)?
Ressourcen effektiv nutzen
Es ist wichtig, dass wir mit unseren Ressourcen bewusst umgehen und sie sinnvoll einsetzen. Wenn diese Ressourcen unnötig verschwendet werden, fehlen uns Kapazitäten für andere Aufgaben, Themen oder Lebensbereiche. Aus diesem Grund ist ein achtsamer und zielgerichteter Umgang mit den persönlichen Ressourcen auch beim Thema Lernen sehr wichtig. Ressourcen wie Konzentration, Motivation oder Energie sollten so genutzt werden, dass keine Überlastung entsteht, da dies langfristig gravierende gesundheitliche Folgen haben kann. Chronische Erschöpfung kann ein Risikofaktor für Erkrankungen wie Depressionen oder Burnout sein.
Fortschritt überprüfen
Regelmäßige Selbsttests oder Reflexionen helfen dabei, den Fortschritt zu messen. Wenn wir feststellen, dass wir vom Ziel abweichen, können wir die Lernziele oder die eingesetzten Strategien anpassen. Eine Selbstreflexion ist ebenfalls hilfreich, um Verbesserungspotenziale bei den eigenen Lernprozessen zu erkennen und die eingesetzten Ressourcen zukünftig zu optimieren.
Fazit: Mit dem ökonomischen Prinzip das Lernen optimieren
Das ökonomische Prinzip bietet eine wertvolle Orientierung, um den Lernprozess effizient zu gestalten. Ob wir das Maximalprinzip anwenden und einen maximalen Ertrag bei gegebenem Mittelaufwand anstreben oder das Minimalprinzip wählen, um mit möglichst geringem Aufwand ein festgelegtes Ziel zu erreichen – beide Ansätze können helfen, die Lernziele effektiv umzusetzen.
Wie setzt du ökonomische Prinzip bei deinem Lernprozess ein? Wie können wir als Ausbilder:innen unseren Lernenden das ökonomische Prinzip näherbringen und es effektiv in der Ausbildung einsetzen? Ich freue mich über Kommentare und auf den direkten Austausch per Mail an info@prüfung-erfolg.de